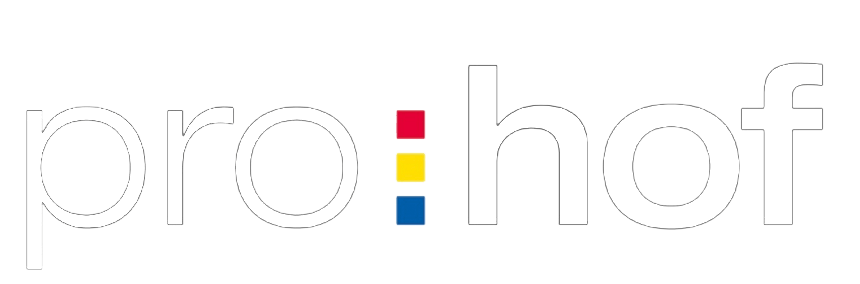Die Hochschule Hof verzeichnet aktuell nicht nur eine Rekordzahl an Studierenden, sondern gleichzeitig auch den höchsten Stand an Forschungsprojekten in ihrer Geschichte. Nicht wenige der derzeitigen Projekte und Entwicklungen sind dabei direkt oder indirekt mit dem Hofer Land und den angrenzenden Regionen verwoben: Viele Forschungsergebnisse vom Campus in Hof werden bereits heute in Unternehmen vor Ort umgesetzt oder stehen absehbar vor ihrer praktischen Anwendung. Die Hochschule Hof ist damit ein gutes Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung einer der großen Innovationstreiber der Region – insbesondere auf dem Feld ökologisch-nachhaltiger Entwicklungen. Wir haben nachgefragt bei Hochschulpräsident Professor Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann:
Deckt die Forschung an der Hochschule Hof die Themen der Unternehmen vor Ort ab? Und ist die Hochschule in der Lage, ihre Studierenden entsprechend auszubilden?
Unsere berufsnahe Lehre geschieht mit hoher Qualität. Unsere Hochschule verzeichnet darüber hinaus zuletzt auch einen bemerkenswerten Zuwachs an eigenen Forschungsthemen und Innovationen. Diese stärken nicht nur die Attraktivität der Hochschule selbst, sondern sie kommen oft zuallererst unserer Region zugute. Vieles davon betrifft Wachstumsbranchen, die einen ökologischen Ansatz verfolgen.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Ein gutes und teilweise bereits sichtbares Beispiel ist die Frage der zukünftigen Mobilität. Die Hochschule Hof koordinierte das vom Bundesverkehrsministerium geförderte Forschungsprojekt „MobiDig“. Dort analysierten Forscherinnen und Forscher von 2017 bis 2020 zusammen mit Partnern aus Wissenschaft und Verwaltung die Mobilitätsbedarfe der Modellregion Hochfranken. Das Resultat sind belastungsfähige Prognosen zu künftigen Verkehrsströmen. Ein weiteres Beispiel ist der Ausbau der bedarfsgesteuerten Mobilität, zum Beispiel in Form des bereits fahrenden Hofer Landbusses. Die Hochschule Hof ist außerdem Forschungspartner der „Shuttle-Modellregion Oberfranken SMO“, die im Rahmen von Projekten in Kronach, Rehau und Hof autonom fahrende Busse weiterentwickelt.
Welche weiteren Forschungsschwerpunkte setzen Sie?
Am Institut für Wasser- und Energiemanagement der Hochschule Hof (iwe) entstehen Innovationen für die Energiewende: Mit Forschungspartnern wurde ein neuartiges Verfahren entwickelt, um aus Biomasse hochwertigen Wasserstoff herzustellen. In der Folge der Entwicklung kam es bereits zu einer Unternehmensgründung. Am Institut für angewandte Biopolymerforschung der Hochschule Hof (ibp) erforscht eine Nachwuchsforschergruppe außerdem den Einfluss natürlicher Strahlung sowie den Einsatz von biogenen Reststoffen auf die Eigenschaften und die Struktur von Biokunststoffen.
Welche praktischen Anwendungen sind hier möglich?
Zum Beispiel die Produktion von biologisch abbaubaren Folien in der Landwirtschaft. Die zunehmend eingesetzten, sogenannten Silagefolien werden bislang konventionell produziert und basieren in der Regel auf Erdöl. Im Boden hinterlassen sie nachweisbares Mikroplastik, außerdem sind die gängigen Folien reine Einwegartikel. Ziel der Forscherinnen und Forscher ist es, dass die Folien zukünftig zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.
Welche Rolle spielt bei Ihren Forschungen die traditionelle Industrie des Hofer Landes?
Auch die profitiert von der Hochschule Hof. Am Institut für Materialwissenschaften (ifm) am Campus Münchberg läuft das EFRE-Projekt (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) „Textilindustrie 4.0“. Es beschäftigt sich mit dem Technologietransfer vor allem an kleine und mittelständische Unternehmen der Region. Vermittelt werden modernste und nachhaltige Verfahren zur Textilproduktion. Beteiligen können sich alle Unternehmen der regionalen Textilbranche, die nicht mehr als 250 Mitarbeiter haben und deren Umsatz 50 Millionen Euro nicht übersteigt.
Wie kommt es, dass die Hochschule Hof sich auf die genannten Gebiete konzentriert hat und dort so erfolgreich geworden ist?
Das Thema Green Tech existiert bereits seit 2008 im Entwicklungskonzept der Hochschule Hof. Dabei wurde die Vision unserer Hochschule bis 2030 festgelegt. Ziel war es damals schon, eine entsprechende, auf Nachhaltigkeit gerichtete Ausrichtung in allen Bereichen – insbesondere natürlich der Forschung – zu erreichen.
Wie darf man sich den Austausch zwischen Hochschule und Unternehmen in der Praxis vorstellen? Welche Rolle spielt die Politik?
Unsere Beziehung zu den Unternehmen ist ausgesprochen vielfältig. Unter anderem durch die dualen Studiengänge, durch Kontakte bei Absolventenfeiern über unsere Fördergesellschaft, durch die Arbeit des Digitalen Gründerzentrums Einstein1, aber auch durch Einzelveranstaltungen mit Unternehmen oder durch Kooperationen im Bereich von Forschungsprojekten gibt es eine Vielzahl an Schnittmengen und es entstehen immer wieder spannende Themen. Die grundsätzliche Linie bestimmt die Hochschule selbst im Rahmen ihrer Autonomie. Die Politik begleitet dies und fördert die entstehenden Ideen – wie zum Beispiel beim Bau neuer Institute.

Wie ist die Hochschule Hof bisher durch die Corona-Zeit gekommen?
Wir waren im Bereich der Digitalisierung bereits vor Corona sehr gut aufgestellt. Wir nutzen beispielsweise Skype for Business für die Kommunikation und alle unsere Mitarbeiter verwenden eigens zur Verfügung gestellte Laptops. Unsere gesamte Verwaltung war damit bereits vor Corona jederzeit vollständig Homeoffice-fähig. Darüber hinaus bedienen wir uns vieler technisch führender Plattformen für die tägliche Arbeit. An diese gute Ausgangslage konnten wir im Sommersemester problemlos anknüpfen. Natürlich aber führt eine solche Situation zu einer Einschränkung der Lehre, da Präsenzunterricht nicht mehr stattfindet und somit auch die Interaktion oft wegfällt.
Zu welchen Problemen führt das?
Wir beobachten mittlerweile gewisse psychische Probleme Einzelner, da die Politik die Studierenden nie im Fokus hatte. Ab dem Wintersemester 2021/22 richten wir unsere Planungen wieder auf Präsenzlehre aus, auch wenn die technischen Voraussetzungen zur Onlinelehre das Angebot natürlich ergänzen werden. Corona hat einen deutlichen Schub im Bereich der digitalen Lehre gebracht, aber wir sind keine Hochschule für Fernstudien – wir wollen in die Präsenzlehre und damit in die Normalität zurück.
Wo sehen Sie die Hochschule Hof in 25 Jahren? Kann bei einer längerfristigen Planung zur weiteren Ausrichtung überhaupt so weit gedacht werden?
Bei der Formulierung einer Vision muss eine Hochschule immer langfristig denken – auch unser letztes Entwicklungskonzept war auf 22 Jahre (2008-2030) angelegt und wird nun entsprechend weiterentwickelt. In 25 Jahren sehen wir die Hochschule Hof als international stark vernetzte und überregional anerkannte Bildungseinrichtung, deren Schwerpunkte auf einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten, interdisziplinären Forschung sowie auf einer starken Verankerung in der Region liegen.
Die Fragen stellte Manfred Köhler