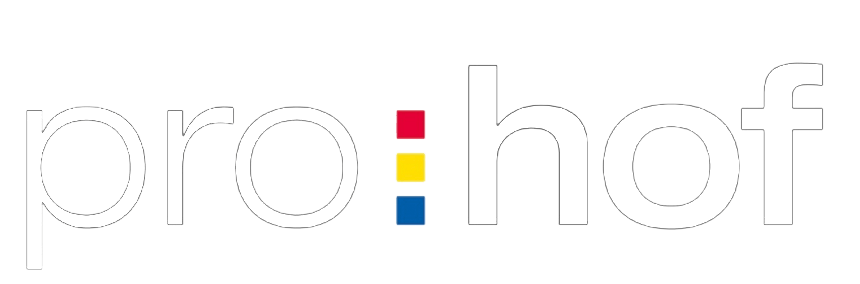Heuer jährte sich das Hambacher Fest, die erste große Volksversammlung in Deutschland vom 27. Mai bis 1. Juni 1832, zum 188. Mal. Kein rundes Jubiläum, doch der Verdienste eines seiner Teilnehmer sollte immer gedacht werden: der lebenslange Kampf des Hofers Johann Georg August Wirth für Freiheit und Einheit.
Wer den Beitrag des Hofers Johann Georg August Wirth (1798-1848) zur Entwicklung der Demokratie in Deutschland verstehen will, der muss sich die politische Situation zu seinen Lebzeiten vor Augen führen: Der „Deutsche Bund“, 1815 als Staatenbund gegründet, bestimmt das Geschehen. 35 souveräne Fürstentümer und vier freie Städte gehören ihm an, darunter auch das Königreich Bayern. Sein Ziel ist, die monarchische Legitimität und Ordnung aufrechtzuerhalten. In vielen deutschen Staaten werden die aufkeimenden liberalen, nationalen und demokratischen Ideen mit polizeilichen Mitteln bekämpft und die vielschichtig verzweigte politische Opposition mit ihren Forderungen nach Einheit und Freiheit durch eine restriktive Gesetzgebung unterdrückt.
Das ist das Klima, in dem Wirth im Jahr 1816 sein Jurastudium in Erlangen beginnt. Seine Schulzeit hat der am 20. November 1798 vermutlich in der Hofer Ludwigstraße 28 (heute Metzgerei Schiller) – und nicht wie lange angenommen am Unteren Tor 4 – als drittes von fünf Kindern geborene Sohn des Kaiserlichen Reichspoststallmeisters Johann Adam Gottlieb Wirth und seiner Frau Wilhelmina Augusta, einer vogtländischen Pfarrerstochter, nicht nur in Hof verbracht. 1803 kommt er in die „gewöhnliche Bürgerschule“. Im gleichen Jahr stirbt sein Vater an den Folgen eines Reitunfalls. 1806 wechselt Wirth ans Gymnasium in Hof. Doch 1811 wird das Hofer Gymnasium auf Befehl des bayerischen Königs geschlossen. Er setzt seine Gymnasialzeit in Bayreuth, Plauen und am humanistischen Egidiengymnasium (heute Melanchton-Gymnasium) Nürnberg fort, wo ihn auch der Philosoph Hegel unterrichtet, der dort Rektor und Lehrer ist.
Nach dem Abitur folgt dann das Jurastudium in Erlangen von 1816 bis 1819. Es ist die Zeit der neu entstehenden Burschenschaften, die – wie beim Wartburgfest im Oktober 1817 – nationale Einheit, Rede- und Pressefreiheit sowie Bürgerrechte fordern. Johann Georg August Wirth wird im Dezember 1817 Mitbegründer der Erlanger Burschenschaft Arminia, die er aber im Januar 1818 wieder verlässt, um sich in der Studentenverbindung Corps Franconia zu engagieren. Ihr bleibt er ein Leben lang treu.
1819, mit 21 Jahren, arbeitet Wirth kurzzeitig als Rechtspraktikant am Fürstlich Schönburgischen Patrimonialgericht in Schwarzenbach an der Saale und hat dort bereits erste Einblicke in das obrigkeitliche und unsoziale bayerische Rechtswesen. Im selben Jahr werden auf der großen politischen Bühne die Karlsbader Beschlüsse gefasst, die in Form von vier Gesetzen die damals als aufrührerisch, heute hingegen als fortschrittlich geltenden Gedanken und Ideen ver- und behindern sollten und weitreichende Konsequenzen haben: Verbot der öffentlichen schriftlichen Meinungsfreiheit und der Burschenschaften, Zensur der Presse, Überwachung der Universitäten, Berufsverbot für liberal und national gesinnte Professoren und sogar die Schließung der Turnplätze.
1820 promoviert Johann Georg August Wirth in Halle zum Dr. jur. und kehrt danach zum Quellenstudium des Römischen Rechts nach Hof zurück. 1821 heiratet er Regina Werner, eine Schwester seines früheren Schwarzenbachers Gerichtsvorstandes Johann Wilhelm Werner. Mit ihr ist er bereits seit 1819 verlobt. Es erfolgt ein Umzug nach Breslau, wo Wirth habilitieren will. Dort wird im Januar 1822 sein erster Sohn Max Wilhelm Gottlob Wirth geboren, ein späterer Journalist und Nationalökonom. Die Familie verlässt Breslau aber bald wieder, da Wirths Habilitation dort scheitert. Er kann die geforderten Gebühren nicht aufbringen. Als Arbeit hatte er einen eigenen Entwurf eines Strafgesetzbuches vorgelegt.
Von 1823 bis 1830 arbeitet er in Bayreuth als Rechtsanwalt in der Kanzlei des damals bekannten liberalen Anwaltes Gottlieb Keim. 1826 wird in Bayreuth sein zweiter Sohn Franz Ulpian Wirth geboren. Dieser wird später zusammen mit Bertha von Suttner und dem Friedensnobelpreisträger Alfred H. Fried Mitbegründer der deutschen Friedensbewegung. Johann Georg August Wirth bekommt während seiner Bayreuther Tätigkeit zunehmend Zweifel am herrschenden Rechtssystem. Er vertritt ärmere Leute und empört sich immer wieder über Prozessverschleppung und überhöhte Gebühren. Seiner Auffassung nach sollten die obersten Leiter nur nach der Wohlfahrt des ganzen Volkes streben. In seiner 1826 verfassten Schrift „Beiträge zur Revision der bürgerlichen Proceßgesetzgebung“ formuliert er diese Gedanken und weist auf Missstände hin – ergebnislos. Wirth beschäftigt sich weiter mit der Thematik und vertieft sich in die sich ausbreitenden liberalen Ideen. Ende 1830 gibt er seine Stellung bei Gottlieb Keim auf und entscheidet sich dafür, nur noch publizistisch tätig zu sein.
Am 1. Januar 1831 gründet er in Bayreuth die Zeitschrift „Kosmopolit“, die zum Ziel hat, freiheitliche Gedanken zu verbreiten. Sie erscheint zweimal in der Woche, bringt es aber insgesamt nur auf sieben Abonnenten und sieben Ausgaben und wird am 28. Januar 1831 mit Inkrafttreten einer weiteren Verschärfung der bayerischen Pressezensur, der sich Wirth nicht beugen will, wieder eingestellt. Dieser Verschärfung vorausgegangen waren internationale Bestrebungen und Aufstände im Jahr 1830 zur Stärkung der liberalen Bewegungen in Europa, die auch in Bayern zu liberalen Erfolgen führten.
Wirth übersiedelt Ende Februar 1831 nach München in der Hoffnung, sich mit diesem Schritt mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, versucht aber vergeblich, selbst wieder ein Blatt zu gründen. Kurzzeitig übernimmt er die Chefredaktion der Zeitschrift „Das Inland“ des deutschen Verlegers, Industriepioniers und Politikers Johann Friedrich Cotta. Doch auch dieses Blatt wird nach Zwistigkeiten mit der Zensur vom Verleger eingestellt und kommt damit der ministeriellen Schließung zuvor.
Dann, am 1. Juli 1831, gründet er in München die liberale Zeitung „Deutsche Tribüne“, die den Untertitel „Zur Wiedergeburt des Vaterlandes“ trägt. Sie wird in der Pressegeschichte zu den bedeutendsten freiheitlichen Oppositionszeitungen gezählt. Mit dem Veröffentlichen von Artikeln in unzensierter Form und damit gegen die Bestimmungen, bringt sie Wirth immer wieder Schwierigkeiten mit den Behörden ein. Hohe Geldstrafen und mehrere Inhaftierungen sind die Folge, gegen die er sich zur Wehr setzt. Um den Jahreswechsel 1831/32 siedeln er, seine Frau und seine mittlerweile drei Kinder, im Jahr 1827 wurde Tochter Rosalie Christiane geboren, auf den Rat des Juristen und Journalisten Philipp Jakob Siebenpfeiffer, nach Homburg an der Saar über. Das gehört damals zum sogenannten „Rheinkreis“, einer Enklave des bayerischen Königreiches. Dort gelten aufgrund der früheren Zugehörigkeit zu Frankreich noch freiheitlichere Verfassungsrechte, was viele Oppositionelle bewog, sich dort anzusiedeln. Dort erscheint am 1. Januar 1832 die erste Homburger Ausgabe der „Deutschen Tribüne“. Doch auch hier bleibt Wirth nicht von Repressalien verschont. Bereits am 4. Januar versiegelt der Bürgermeister seine Druckerpresse. Die „Deutsche Tribüne“ erscheint daraufhin zunächst in Zweibrücken.
Die Situation spitzt sich zu, als Wirth gemeinsam mit Gleichgesinnten, unter anderem Siebenpfeiffer, am 29. Januar 1832 den Deutschen Vaterlandsverein zur Unterstützung der Freien Presse, kurz „Deutscher Preß- und Vaterlandsverein“ (PVV) in Zweibrücken gründet. In der „Deutschen Tribüne“ erscheint am 3. Februar Wirths Artikel „Deutschlands Pflichten“ mit einem Aufruf zur ideellen und materiellen Unterstützung des PVV. Die Folge der weiteren Auseinandersetzung zwischen Wirth und den Behörden ist das Verbot der „Deutschen Tribüne“ am 1. März 1832 durch die bayerische Regierung und tags drauf durch die Preßkommission des Deutschen Bundes, die zudem Folgepublikationen und ein fünfjähriges Berufsverbot für die verantwortlichen Hauptredakteure verhängte. Weil aber am 13. März erneut eine Ausgabe erscheint – die letzte übrigens am 21. März 1832 –, wird Wirth von der bayerischen Regierung festgenommen und inhaftiert. Es kommt in Zweibrücken zum Prozess, der für Wirth am 14. April 1832 mit einem Freispruch endet. Die Richter erkennen kein Verschulden Wirths gegen die Zensur und betonen die Freiheit der Presse.

Bereits am 20. April 1832 lädt Siebenpfeiffer zum berühmten Hambacher Fest am 27. Mai 1832, der ersten großen Volksversammlung mit rund 30.000 Teilnehmenden auf dem Hambacher Schloss. Maßgeblicher Mitorganisator und einer der wichtigsten Festredner: Johann Georg August Wirth. Wie alle Redner fordert auch er in seiner Rede nationale Einheit, Freiheit, insbesondere Versammlungsfreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit, Bürgerrechte, Volkssouveränität und eine Neuordnung Europas auf der Grundlage gleichberechtigter Völker.
Wirth ist es auch, der nach dem Hambacher Fest die offizielle Festbeschreibung verfasst. Als sie erscheint, sitzt er als einer der Organisatoren und Redner des Hambacher Festes bereits wieder in Untersuchungshaft, verhaftet am 18. Juni 1832. Damit rechnet er, lehnt aber im Gegensatz zu einigen seiner Mitstreiter eine Flucht ab. Erst im Juli 1833 beginnt der Prozess in Landau. Während seiner Haftzeit in Zweibrücken verfasst Wirth die Schrift „Die politische Reform Deutschland(s?) – Noch ein dringendes Wort an die deutschen Volksfreunde“. Darin fordert er erneut ein neues Strafrecht. Sein Ururenkel Christof Müller-Wirth schreibt in einer Publikation, Wirths elfjähriger Sohn Max habe die Schrift unter dem Hemd aus dem Gefängnis geschmuggelt.
Diese Schrift sowie die im April 1832 verfasste Publikation „Aufruf an die Volksfreunde“, in der er unter anderem seine Vorstellungen von einer Verfassung darlegt, spielen auch beim Prozess vor dem Geschworenengericht (Assisenprozess) in Landau vom 29. Juli bis 16. August 1833 eine Rolle. Schuldvorwurf: „Direkte Aufforderung zum Umsturz der bayerischen Staatsregierung“. Da diese Unruhen befürchtet, werden 3.000 Mann Militär in der Region zusammengezogen. Wirth verteidigt sich selbst, spricht mehrmals, insgesamt acht Stunden. Die zwölf Geschworenen sprechen ihn und seine Mitangeklagten frei. Wirth bleibt allerdings in Haft. Wegen früherer angeblicher Beleidigungsdelikte gegenüber in- und ausländischen Behörden wird er im November 1833 vom Zuchtpolizeigericht in Zweibrücken zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und in Kaiserslautern inhaftiert. Auf dem Weg nach Kaiserslautern wollen ihn Gleichgesinnte befreien, was Wirth ablehnt. Er möchte rehabilitiert werden. Aber auch nach dieser Haft ist er noch nicht endgültig frei. Vom 24. April bis 9. Juni 1836 muss er in Passau noch eine sechswöchige sogenannte Kontumazstrafe absitzen, die seinerzeit wegen Nichterscheinens vor Gericht verhängt wird.
Nach seiner Haftentlassung lebt er unter polizeilicher Aufsicht in Hof, zuerst im damaligen „Hotel zum Weissen Lamm“ in der Altstadt (heute Bankgebäude), danach wohl bei seinen Verwandten in der Ludwigstraße 28. Seine Heimatstadt nimmt ihn nach den Recherchen seines Ururenkels Christof Müller-Wirth nur widerwillig auf, nachdem keine andere der angefragten Städte ihn haben will. In Hof wird er nach dessen Recherchen damals als „gescheiterter Hambacher“ und später als „Exilant“ politisch abgelehnt. Aus einem Informationsblatt der Stadt Hof zu einem Stadtspaziergang auf Wirths Spuren ist zu lesen, dass Wirth während seiner Zeit in Hof häufig in den Räumen der Alten Bürgergesellschaft (heutige Stadtpost) verkehrte. Die Polizeiaufsicht wird erst im September 1840 aufgehoben.
Da ist Wirth schon lange nicht mehr im bayerischen Hoheitsgebiet. Ende 1836 gelingt ihm die Flucht zu seiner Familie ins elsässische Weißenburg. Dorthin war seine Frau Regina mit den drei Kindern auf Anraten Wirths 1832 geflohen, da auch sie durch den Verkauf von Wirths Schriften ins Visier der Behörden geraten war. Während seiner Inhaftierung steht Wirth mit seiner Familie im Briefkontakt, aus dem auch hervorgeht, dass die Kinder in Weißenburg das Gymnasium besuchen. 62 Briefe sind überliefert.
Wiedervereint mit der Familie beginnt eine unstete Zeit. Im Februar 1837 zieht die Familie nach Nancy, um 1838 nach Straßburg und 1839 ins schweizerische Kreuzlingen zu übersiedeln. Im nahe gelegenen Konstanz wird er Herausgeber der Zeitschrift „Deutsche Volkshalle“. Weil auch ihr Erscheinen durch die Zensur immer schwieriger wird, wird sie im Laufe des Jahres 1841 eingestellt. In dieser Zeit beginnt er auch seine „Geschichte der Deutschen“ zu schreiben, deren erster Band 1842 erscheint.
1846 wird eine Generalamnestie für die verfolgten Hambacher erlassen. Ein Jahr später begibt sich Wirth nach Karlsruhe. Sein Ururenkel vermutet, dass diese Entscheidung mit dem pressefreundlichen Klima in der badischen Residenz zusammenhing. Zudem hatte er im Bankier, Verleger und zweimaligem Oberbürgermeister August Klose einen Partner für sein letztes Geschichtswerk „Geschichte der deutschen Staaten von der Auflösung des Reiches bis auf unsere Tage“ gefunden.
Im März 1848 lebt die republikanische Bewegung im Zuge der Märzrevolution wieder auf. In den Jahren nach 1832 waren vom Deutschen Bund vermehrte Repressalien in Kraft gesetzt worden, die sie zunächst zum Erliegen gebracht hatten und die führenden Köpfe des Hambacher Festes ins Exil gezwungen hatten. Ins erste demokratisch gewählte Parlament Gesamtdeutschlands, die Frankfurter Nationalversammlung, die in der Paulskirche tagt, werden einige von ihnen von der Bevölkerung gewählt – auch Johann Georg August Wirth. Sein Mandat hatte er im vogtländischen Hirschberg erhalten, das zum Fürstentum Reuß-Schleiz-Lobenstein gehört. Wie sein Ururenkel schreibt, hatte sich der liberale Hirschberger Lederfabrikant Philipp Knoch für Wirth eingesetzt. Der eigentliche Hirschberger Kandidat Robert Blum, ein Zeit- und Weggenosse Wirths, hatte bereits ein Mandat in Leipzig errungen. Aus der Nachwahl Mitte Juni 1848 ging Wirth gegen seinen Freund August Thieme als Sieger hervor. Die Mitglieder der Hofer Gartengesellschaft hatten eine Kandidatur Wirths in Hof verhindert, da sie erreichten, dass nur Kandidaten zur Wahl zugelassen wurden, die der konstitutionellen Monarchie zuneigten.
Wirth konnte sein Mandat aber nur sechs Wochen wahrnehmen. Am 26. Juli 1848 stirbt er ganz plötzlich in Frankfurt am Main und wird in einem Ehrengrab beigesetzt. Der Trauerzug für ihn war der größte, den die Stadt bis dahin gesehen hatte.

In seiner Heimatstadt Hof hat man im Jahr 1927 auf Betreiben der SPD, die die Verdienste Wirths um Demokratie und Nation zu dieser Zeit wieder thematisierte, die Wirth-Straße nach ihm benannt, eine Parallelstraße der Enoch-Widman-Straße. Den Dr.-Wirth-Platz in der Innenstadt nahm von 1998 bis 2012 ein Denkmal nach einem preisgekrönten Entwurf des Bildhauers Prof. Andreas Theurer, Dozent am Bauhaus Dessau, ein: ein zwölf Meter langes und neun Meter breites aus weißen und schwarzen Pflastersteinen gefügtes Zeitungsblatt in Wellenform, das an die Titelseite von Wirths Zeitung „Deutsche Tribüne“ und damit an sein Engagement für die Pressefreiheit erinnert. Weil der Platz an der Karolinenstraße im Rahmen des Kernstadtprozesses aber einer neuen Nutzung zugeführt werden sollte, nämlich drei Sitzinseln mit Bäumen, entschied man sich 2012 mit dem Neubau der Freiheitshalle für eine Verlegung des Wirth-Denkmals an die Außenanlagen der Halle an der Kulmbacher Straße. Dort ist es noch heute, in einer Größe von acht Metern Länge und sechs Metern Breite, zu sehen. Doch wie groß oder klein ein Denkmal für Johann Georg August Wirth auch immer ausfällt: Seine Verdienste um die Demokratie in Deutschland sind enorm. Sabine Schaller-John